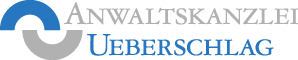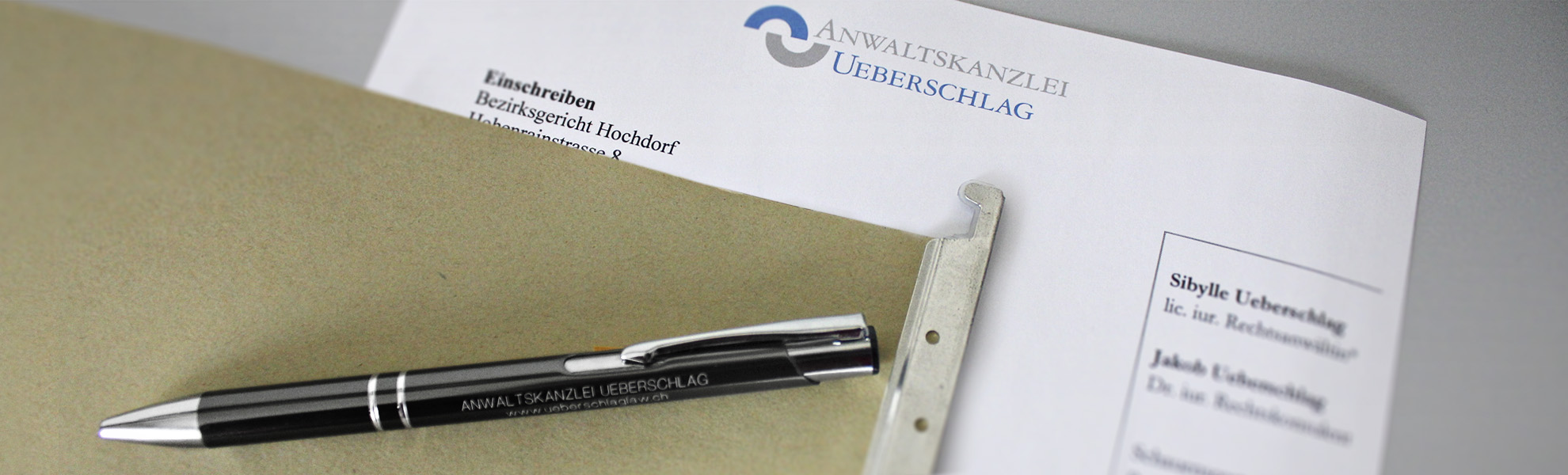Aktuelles
1. Was ist ein Vorsorgeauftrag?
2. Wie ist ein Vorsorgeauftrag zu verfassen?
3. Was sollte hinsichtlich des Inhalts eines Vorsorgeauftrags beachtet werden?
4. Wer hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen?
5. Wie hoch sind die Ergänzungsleistungen?
6. Wie werden Einkünfte und Vermögenswerte behandelt, auf welche verzichtet wurde?
1. Was ist ein Vorsorgeauftrag?
Mittels Vorsorgeauftrag kann eine handlungsfähige – d.h. urteilsfähige und mündige – Person selbst bestimmen, durch wen und wie sie im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit betreut werden will. Die Betreuung kann dabei die Personen- und Vermögenssorge sowie die Vertretung in rechtlichen Angelegenheiten umfassen. Insgesamt ermöglicht ein Vorsorgeauftrag folglich Selbst- statt Fremdbestimmung.
Urteilsunfähig sind dabei Personen, welche infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rauschzuständen oder ähnlichem die Fähigkeit zum vernunftgemässen handeln nicht mehr haben. Dies kann nach einem Unfall oder einer schweren Erkrankung ebenso der Fall sein, wie bei einer Altersdemenz.
Geht die Urteilsfähigkeit verloren, wird die KESB die im Vorsorgeauftrag aufgeführte Person anstelle eines Beistandes für die Betreuung einsetzen. Die permanente Aufsicht durch die KESB entfällt alsdann.
2. Wie ist ein Vorsorgeauftrag zu verfassen?
Er ist eigenhändig niederzuschreiben (inkl. Datum und Unterschrift) oder öffentlich durch einen Notar zu beurkunden.
3. Was sollte hinsichtlich des Inhalts eines Vorsorgeauftrags beachtet werden?
- Die einfachste Variante ist, für alle Angelegenheiten eine einzige Vertretungsperson zu bezeichnen. Man kann jedoch auch pro Angelegenheit (Personensorge, Vermögenssorge, Rechtsverkehr) je eine andere Vertretungsperson bezeichnen.
- Man sollte unbedingt nicht nur eine Vertretungsperson, sondern auch eine Ersatzvertretungsperson bezeichnen, für den Fall dass die erstbeauftragte Person z.B. selbst urteilsunfähig oder nicht auffindbar ist.
- Mindestinhalt:
a) Wichtig ist, dass der/die Auftraggeber(in) und die Vertretungsperson (sowie Ersatzvertretungsperson) klar bestimmt sind (Name und Wohnort).
b) Des Weiteren muss klar festgehalten werden, dass der Auftrag erst mit Eintritt der Urteilsunfähigkeit des Auftraggebers Wirkung entfaltet.
c) Schliesslich muss der Aufgabenbereich der Vertretungsperson zumindest generell umschrieben werden, da sonst von einem umfassenden Vorsorgeauftrag ausgegangen wird (für Personen-, Vermögenssorge und Rechtsverkehr).
- Geregelt werden kann auch eine angemessene Entschädigung, welche der beauftragten Person für ihre Leistungen zukommen soll. Wird dies vom Auftraggeber im Vorsorgeauftrag nicht geregelt, so wird bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit allenfalls eine angemessene Entschädigung von der Erwachsenenschutzbehörde festgesetzt.
- Das Zivilstandsamt trägt auf Antrag die Tatsache, dass eine Person einen Vorsorgeauftrag errichtet hat, und den Hinterlegungsort in eine zentrale Datenbank ein.
- Der Vorsorgeauftrag kann jederzeit widerrufen und gegebenenfalls ein neuer verfasst werden. Auch der Widerruf muss jedoch handschriftlich verfasst werden.
4. Wer hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen?
Ergänzungsleistungen können gemäss Art. 4 ff. ELG Personen erhalten, welche
- einen Anspruch auf eine Rente der AHV (auch bei Rentenvorbezug), eine Rente der IV (ganze, Dreiviertels-, halbe oder Viertelsrente), oder nach Vollendung des 18. Altersjahres eine Hilflosenentschädigung der IV beziehen oder während mindestens sechs Monaten ein Taggeld der IV erhalten,
- in der Schweiz Wohnsitz und tatsächlichen Aufenthalt haben (Exportverbot: Entsprechend kann z.B. eine Schweizer AHV-Rentnerin, welche ihren Lebensabend in Brasilien verbringen will, nicht auf Ergänzungsleistungen zählen; dies gilt auch für EU- und EFTA-Mitgliedstaaten),
- BürgerIn der Schweiz sind (berechtigt sind auch AusländerInnen, welche seit mindestens 10 Jahren ununterbrochen in der Schweiz leben, Flüchtlinge und Staatenlose, welche seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen in der Schweiz leben sowie i.d.R. ohne Karenzfrist EU- und EFTA-AusländerInnen) und
- deren anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen.
5. Wie hoch sind die Ergänzungsleistungen?
Jährliche Ergänzungsleistungen, welche monatlich zur Auszahlung kommen, entsprechen der Differenz zwischen den anerkannten Ausgaben und den anrechenbaren Einnahmen einer versicherten Person. Was zu den anerkannten Ausgaben gezählt wird, ist in Art. 10 ELG geregelt, was zu den anrechenbaren Einnahmen in Art. 11 ELG.
Zumal Ergänzungsleistungen die Deckung der laufenden Lebensbedürfnisse bezwecken, dürfen grundsätzlich nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte berücksichtigt werden, über welche die leistungsansprechende Person ungeschmälert verfügen kann. Vorbehalten bleibt aber der Tatbestand des Vermögensverzichts: Als Einnahmen werden nämlich gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG auch Einkünfte und Vermögenswerte angerechnet, auf welche verzichtet worden ist.
6. Wie werden Einkünfte und Vermögenswerte behandelt, auf welche verzichtet wurde?
Als Einnahmen werden auch Einkünfte und Vermögenswerte angerechnet, auf welche verzichtet worden ist (Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG).
Die Anrechnung des Einkommens- und Vermögensverzichts dient vordergründig der Verhinderung von Rechtsmissbräuchen – Leistungsansprechende sollen nicht zulasten der Versicherung auf Einkommen verzichten oder sich vorhandener Vermögenswerte entäussern. Damit ist Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG auch Ausdruck der ergänzungsleistungsspezifischen Schadenminderungspflicht, gemäss welcher Leistungsansprechende ihren Existenzbedarf soweit möglich und zumutbar aus eigener Kraft bestreiten müssen.
Das Gesetz führt hingegen nicht aus, unter welchen Voraussetzungen ein anrechenbarer Vermögensverzicht gegeben ist. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 134 I 65, E. 3.2; 131 V 329, E. 4.2) erfolgt eine Anrechnung, wenn
- ohne rechtliche Verpflichtung (z.B. ein Erbvorbezug; Die Erfüllung einer moralischen Pflicht genügt nicht) und
- ohne adäquate Gegenleistung (z.B. Schenkung einer Liegenschaft)
auf Einkünfte oder Vermögen verzichtet wurde. Dabei sind die beiden Voraussetzungen alternativ zu verstehen.
7. Welche allgemeinen Grundsätze gilt es bei der Anrechnung eines Einkommens- und Vermögensverzichts zu beachten?
- Praxisgemäss ist eine Gegenleistung gleichwertig, wenn ihr Wert mind. 90 % des Leistungswerts beträgt. Diesfalls findet keine Anrechnung statt.Massgebend ist eine wirtschaftliche, materielle Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung. Die Prüfung erfolgt nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen von Art. 17 ELV auf den Zeitpunkt der Entäusserung hin. Allfällige spätere Wertsteigerungen bleiben in aller Regel unberücksichtigt.
- Ist die Gegenleistung nicht gleichwertig, entspricht die Höhe des Verzichtseinkommens bzw. -vermögens der Differenz zwischen Leistung und Gegenleistung.
- Zusätzlich zum Vermögensverzicht können die Zinserträge, die auf dem Verzichtsvermögen erzielbar gewesen wären, als Einnahmen angerechnet werden.
- Auf ein vorsätzliches Handeln bzw. eine Schädigungsabsicht kommt es für die Anrechnung nicht an.
- Vermögens- bzw. Einkommensverzichte verjähren nicht. Insofern können die Behörden auch Verzichte, welche zehn, zwanzig und mehr Jahre zurückliegen berücksichtigen.
- Der anzurechnende Betrag wird beim Vermögensverzicht (nicht hingegen auch beim Einkommensverzicht) jährlich – erstmals im 2. Jahr nach dem Verzicht – um CHF 10‘000.- vermindert, wodurch sich die Folgen des Vermögensverzichts für die leistungsansprechende Person laufend lindern (Art. 17a ELV).
- Ein Rentenvorbezug i.S.v. Art. 40 AHVG wird gemäss Art. 15a ELV nicht als Einkommensverzicht gewertet.
8. Wie wird ein Erbvorbezug (dasselbe gilt bei Schenkungen) als Vermögensverzicht bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen berücksichtigt?
Beispiel:
Herr Käch (alleinstehend) gewährt seiner Tochter am 20.07.2008 einen Erbvorbezug von CHF 160‘000.- für einen Hauskauf. 2017 muss er ins Pflegeheim und meldet sich, angesichts der hohen Heimkosten und seinen dafür nicht ausreichenden Altersrenten, zum Ergänzungsleistungsbezug an.
Merke:
Da keine gesetzliche Pflicht für den Erbvorbezug besteht und auch keine Gegenleistung erfolgte, wird die zuständige Ergänzungsleistungsstelle den Erbvorbezug als Vermögensverzicht qualifizieren.
Angerechnet werden per 1. Januar (vgl. Art. 17a ELV):
- 2009: CHF 160‘000.- (unverändert)
- 2010: CHF 150‘000.- (erstmalige Reduktion um CHF 10‘000.-)
- 2011: CHF 140‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2012: CHF 130‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2013: CHF 120‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2014: CHF 110‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2015: CHF 100‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2016: CHF 90‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2017: CHF 80‘000.- Verzichtsvermögen per EL-Anmeldung
Zu berücksichtigendes Vermögen per EL-Anmeldung:
| Vermögensverzicht: | CHF 80‘000.- | |
| + übriges Vermögen: | CHF 20‘000.- | (Annahme) |
| - Freibetrag Alleinstehende: | CHF 37‘500.- | (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG) |
| relevantes Vermögen: | CHF 62‘500.- |
Anrechnung als Vermögensverzehr: 1/10* von CHF 62‘500.- = CHF 6‘250.- (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG).
*Da Herr Käch Altersrentner ist – sonst 1/15. Zu beachten ist, dass gemäss Art. 11 Abs. 2 ELG die Kantone den Vermögensverzehr für in Heimen oder Spitälern lebende Personen auf höchstens 1/5 erhöhen können. So sieht z.B. § 5 des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV des Kantons Luzern (SRL 881) vor, dass der Vermögensverzehr für in Heimen oder Spitälern lebende Personen 1/5 beträgt.
Vorbehältlich eines weiteren Verzichts reduzieren sich die CHF 80‘000.- jährlich um weitere CHF 10‘000.-. Der Verzicht wird also nicht unendlich mitgetragen, sondern ist in unserem Beispiel nach einigen Jahren «getilgt». Zudem wird der Ertrag, welcher aus dem verzichteten Vermögen erzielbar wäre, als Einnahme angerechnet: Wenn wir von einer durchschnittlichen Verzinsung von 0.1 % ausgehen, wären CHF 80.- (CHF 80’000.- / 1’000) anzurechnen. Dieser Betrag reduziert sich in den Folgejahren entsprechend. Bei gleichbleibender Verzinsung werden im nächsten Jahr folglich CHF 70.- (CHF 70‘000.- / 1‘000) und im übernächsten Jahr CHF 60.- (CHF 60‘000.- / 1‘000) usw. angerechnet.
9. Wie wird eine gemischte Schenkung einer Liegenschaft gegen Einräumung einer lebenslänglichen Nutzniessung bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen berücksichtigt?
Beispiel:
Herr Dubach (alleinstehender AHV-Rentner) besitzt ein selbst bewohntes Einfamilienhaus, welches er an seinem 64. Geburtstag seinem Sohn überschreibt. Dieser übernimmt die Hypotheken und Herr Dubach behält die lebenslängliche Nutzniessung am Haus und kommt für die Hypothekarzinsen sowie den Gebäudeunterhalt auf.
I. Berechnung des Kapitalwerts der Nutzniessung
1. Ermittlung des Kapitalisierungsfaktors
Der Kapitalisierungsfaktor wird anhand folgender Formel bestimmt (BGE 122 V 394, E. 4b):
| CHF 1‘000.- | |
| Kapitalisierungsfaktor = | |
| Jahresrente gemäss Tabelle* |
*Eidg. Steuerverwaltung ESTV: Tabelle zur Umrechnung von Kapitalleistungen in lebenslängliche Renten – Werte ab dem Jahr 2005; zu finden auf https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/tarife.html
Alter der begünstigten Person: 64
Jahresrente gemäss Tabelle: 49.18
Kapitalisierungsfaktor: 20.33 (CHF 1‘000.-/49.18)
2. Kapitalwertberechnung
| Bruttojahreswert: | CHF 30‘000.- | (= Marktmietwert)* |
| - Hypothekarzinsen: | CHF 2‘400.- | (Annahme 1.2%) |
| - Gebäudeunterhaltskosten: | CHF 3‘000.- | (Pauschalabzug von 10%)** |
| Nettojahreswert: | CHF 24‘600.- |
Kapitalwert: CHF 500‘118.- (Nettojahreswert CHF 24‘600 x Kapitalisierungsfaktor 20.33)
*Mittlerer Mietzins für vergleichbare Objekte an vergleichbarer Lage.
**Massgebend für Gebäude, welche noch nicht 10 Jahre alt sind; für ältere Gebäude gilt grundsätzlich ein Pauschalabzug von 20%.
II. Höhe des Vermögensverzichts
Höhe der Leistung:
| Liegenschaft | CHF 950‘000.- | (= Verkehrswert)* |
| Total | CHF 950‘000.- |
*Vgl. Art. 17 Abs. 5 ELV; massgebend ist der aktuelle Marktwert. Ist dieser nicht bekannt, so ist auf den Mittelwert zwischen dem Wert nach kantonaler Steuergesetzgebung über die direkte Kantonssteuer und dem Gebäudeversicherungswert abzustellen, sofern dies nicht offensichtlich zu einem unrichtigen Ergebnis führt.
Höhe der Gegenleistung:
| Nutzniessung | CHF 500‘118.- | |
| + Übernahme Hypotheken | CHF 200‘000.- | (Annahme) |
| Total | CHF 700‘118.- |
Höhe des Vermögensverzichts:
| Wert der Leistung | CHF 950‘000.- | |
| - Wert der Gegenleistung | CHF 700‘118.- | (73.70% der Leistung)* |
| Verzichtsvermögen | CHF 249‘882.- |
*Da der Wert der Gegenleistung weniger als 90 % der Leistung beträgt, wird die Gegenleistung nicht als geleichwertig betrachtet und es liegt ein anrechenbares Verzichtsvermögen vor.
III. Anrechenbarer Betrag
| Vermögensverzicht: | CHF 249‘882.- | |
| - Freibetrag Alleinstehende: | CHF 37‘500.- | (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG) |
| relevantes Vermögen: | CHF 212‘382.- |
Anrechnung als Vermögensverzehr: 1/10* von CHF 212‘382.- = CHF 21‘238.20 (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG).
*Da Herr Dubach Altersrentner ist – sonst 1/15.
Vorbehältlich eines weiteren Verzichts reduzieren sich die CHF 249‘882.- jährlich – ab dem 2. Jahr nach dem Verzicht – um CHF 10‘000.- (Art. 17a ELV). Zudem wird der aus dem verzichteten Vermögen erzielbare Ertrag als Einnahme angerechnet: Wenn wir von einer durchschnittlichen Verzinsung von 0.1 % ausgehen, wären CHF 249.90 (CHF 249‘882.- / 1‘000) anzurechnen. Der Betrag reduziert sich in den Folgejahren entsprechend. Bei gleichbleibender Verzinsung werden im nächsten Jahr folglich CHF 239.90 (CHF 239‘882.- / 1‘000) und im übernächsten Jahr CHF 229.90 (CHF 229‘882.- / 1‘000) usw. angerechnet.
10. Wie ist das Verhältnis von Ergänzungsleistungen zu Sozialhilfe sowie Verwandtenunterstützungspflicht?
Wird der Anspruch auf Ergänzungsleistung infolge eines Vermögens- bzw. Einkommensverzichts abgelehnt, bleibt nur der Gang zum Sozialamt. Bevor dieses allerdings Leistungen erbringt, wird die sog. Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB) im Verhältnis Kinder-Eltern-Grosseltern (Verwandte in auf- und absteigender Linie) geprüft.
Sofern es den Kindern finanziell und persönlich zumutbar ist, müssen diese ihre Eltern unterstützen. Die Zumutbarkeit ist dabei umso eher gegeben, als der Vermögensverzicht zu deren Gunsten ging. Insofern werden die durch den Vermögensverzicht Bedachten am Ende gegebenenfalls doch noch zur Kasse gebeten. Dieses Risiko (Bumerangeffekt) muss bei einem Vermögens- oder Einkommensverzicht immer beachtet werden.
Gemäss den Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) soll eine Unterstützungspflicht von Verwandten erst dann greifen, wenn das steuerbare Einkommen die folgenden Beträge übersteigt:
- Ehepaare, eingetragene Paare: CHF 180‘000.-
- Zuschlag pro Kind in Ausbildung: CHF 20‘000.-
- Alleinstehende: CHF 120‘000.-
Beim Vermögen wird Alleinstehenden ein Freibetrag von CHF 250‘000.- und Ehepaaren ein solcher von CHF 500‘000.- sowie pro Kind von CHF 40‘000.- belassen. Vom übersteigenden Teil wird ein Vermögensverzehr von zwischen 1/60 (bei unter 30-Jährigen) und 1/20 (bei über 61-Jährigen) beim Einkommen eingerechnet.